Liewo-Weihnachtsspende
Unglücklich trotz Kinderglück: Eine betroffene Mutter erzählt

Als ich nachts nicht mehr schlafen konnte und mir der Appetit fehlte, wusste ich: etwas stimmt nicht», erzählt Michaela M.* Die Mutter zweier Kinder ist eigentlich eine lebensfrohe Person. Die Menschen in ihrem Umfeld kennen sie als aufgestellte und fröhliche Frau – selbst als sie vor einem Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes an einer postpartalen Depression litt. «Solange ich von Menschen umgeben war, ging es mir besser.» War sie allein, wurde sie immer öfter von düsteren Gedanken und Sorgen geplagt.
So wie Michaela geht es vielen Frauen nach der Geburt eines Kindes. Etwa 10 bis 15 Prozent der jungen Mütter sind von einer postpartalen Depression – auch Wochenbettdepression genannt – betroffen. In der Schweiz sind das rund 13 000 Frauen pro Jahr. Aber auch bei den Vätern ist eine solche Erkrankung nicht unüblich. Trotz der grossen Betroffenheit und der Ernsthaftigkeit dieser Krankheit, wird sie nicht selten unterschätzt. Die meisten Betroffenen leiden still. Vielen ist nicht einmal bewusst, dass sie an einer Depression leiden. Andere wiederum schämen sich für ihre Gefühle und überspielen diese. Unbehandelt kann eine postpartale Depression jedoch schwerwiegende Probleme verursachen – sowohl für die Mutter, als auch das Kind und den Partner.
Mehr als nur ein «Babyblues»
Ärzte, Hebammen und Krankenhauspersonal sind mittlerweile sensibilisiert für das Thema. Auch bei Michaela sei der erste, der eine Wochenbettdepression bei ihr vermutete, der Kinderarzt gewesen. «Als er mich bei einer Routineuntersuchung fragte, wie es mir gehe, bin ich in Tränen ausgebrochen», erinnert sich die zweifache Mutter. Nach dem Gespräch, habe sie die Praxis mit gemischten Gefühlen verlassen. Eine Depression wollte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wahrhaben. «Als dann die Schlaf- und Appetitlosigkeit dazu kamen, musste ich mir eingestehen, dass der Kinderarzt recht hatte.»
Etwa vier von fünf Frauen durchleben nach der Geburt den sogenannten «Babyblues». Die Symptome wie zum Beispiel Weinen, Erschöpfung und fehlendes Mutterglück sind unter anderem auf die Hormonumstellung des Körpers zurückzuführen. In der Regel klingen diese depressiven Stimmungsschwankungen nach ein paar Tagen wieder ab. Eine postpartale Depression zeigt sich in den meisten Fällen erst einige Wochen nach der Geburt. So auch bei Michaela. «Ich verliess das Krankenhaus unbeschwert und war glücklich, ein gesundes Kind geboren zu haben», erinnert sie sich.
Die psychische Erkrankung kann verschiedene Ursachen haben. Manche Mütter waren schon vor der Schwangerschaft bzw. der Geburt ihres Kindes depressiv. Bei anderen liegen psychische Erkrankungen in der Familie. Und manchen macht die Umstellung auf das Muttersein oder die aktuellen Lebensumstände zu schaffen. «Bei mir war es ein Gefühl von Überforderung», sagt Michaela. Plötzlich waren da zwei Kinder, die gleichermassen Aufmerksamkeit forderten. Die eigenen Bedürfnisse rutschten immer mehr und mehr in den Hintergrund. «Ich hatte oft dem einen Kind gegenüber ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich längere Zeit um das andere kümmerte.» Die Gedanken kreisten um die Kinder, die Familie, den Haushalt – viele Kleinigkeiten, die sie nicht in Ruhe liessen. «Ich dachte, das ist normal. Dass sich der Alltag mit zwei Kindern mit der Zeit schon einspielen wird.»
Auf der Suche nach Hilfe
Nachdem sich Michaela eine mögliche Depression eingestanden hatte, suchte sie sich rasch Hilfe. Doch das war leichter gesagt, als getan. «Das war unglaublich schwer. Ich musste immer von mir aus aktiv werden, immer neue Termine vereinbaren und in Wartezimmern ausharren.» Hinzu kam, dass jene Stellen, die ihr die nötige Hilfe hätten bieten können, restlos ausgebucht waren. Eine Klinik in der Ostschweiz hat die zweifache Mutter zum Erstgespräch eingeladen. Der nächste freie Termin war drei Wochen später. Ob eine Behandlung möglich gewesen wäre, weiss sie nicht. Sie konnte den Termin später absagen, da es ihr wieder besser ging. «Es währe ohnehin nur eine ambulante Lösung in Frage gekommen. Ich habe zu der Zeit noch gestillt. Abgesehen davon: wer hätte sich während meiner Abwesenheit um die Kinder kümmern sollen? Mein Mann ist berufstätig.»
Gerade für psychisch schwer erkrankte Mütter ist eine stationäre Behandlung über mehrere Wochen sinnvoll. Doch nur selten gibt es Einrichtungen, die eine Mutter-Kind-Therapie anbieten. In den meisten Fällen wird die Mutter ohne Kind behandelt. Für viele Betroffene ist das keine Option. Doch selbst wenn sich eine Mutter-Kind-Therapie anbietet, kann diese nicht immer in Betracht gezogen werden. Diese ist nämlich mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Während die Behandlung der Mutter von den Krankenkassen abgedeckt wird, so müssen die Familien für die Betreuung des Kindes selbst aufkommen. Bei rund 75 Franken pro Tag und einer Therapiedauer von acht bis zwölf Wochen, kommt eine stolze Summe zusammen, die sich nur die wenigsten leisten können.
Medikamente und Selbsthilfe
Antidepressiva halfen Michaela, am Anfang ihr Stimmungstief zu überwinden und wieder aktiver zu werden. Zudem zog sie mit den Kindern für einige Wochen zu ihren Eltern. «Ich hatte das Glück, bei ihnen Stütze und Halt zu finden», sagt sie. «Sie haben mir sofort ihre Hilfe angeboten und mich im Alltag wirklich sehr entlastet. Und auch mein Ehemann und viele meiner Freunde waren mir in dieser Zeit eine grosse Hilfe.» So konnte Michaela sich nicht nur ganz auf sich und ihre Kinder konzentrieren, sondern hatte auch die nötige Zeit, um sich Unterstützung zu suchen. Dabei klopfte die zweifache Mutter bei einigen Ärzten und Beratungsstellen an. «Doch so recht helfen konnte mir keiner. Ich war nach den Gesprächen oft demotiviert», erinnert sie sich. Denn obwohl das Bewusstsein für die postpartale Depression da ist, fehlt es nicht selten an der praktischen Erfahrung im Umgang mit der Krankheit. Das liegt vor allem daran, dass sich Betroffene nur sehr selten melden.
Eine die mit Wochenbettdepressionen öfter in Kontakt kommt, ist Michaelas Hebamme. «Sie war die erste, bei der ich mich aufgehoben fühlte und mir ein paar praktische Tipps und Entspannungstechniken mit an die Hand geben konnte.» Auch einige Beratungssitzungen hat sie in Anspruch genommen. «Doch ich habe gemerkt, dass mir das Reden allein nicht so viel bringt.»
Dank einer gut eingestellten Medikation, der Unterstützung zuhause und verschiedenen Selbsthilfetechniken, schaffte sie es, selbst aus der Depression zu finden. «Hätte es eine Möglichkeit für eine stationäre Therapie mit meinen Kindern gegeben, hätte ich sie auf jeden Fall in Anspruch genommen. Denn in einer solchen Situation selbst aktiv werden zu müssen, ist unglaublich kräftezehrend», sagt sie. Die Antidepressiva hat sie mittlerweile abgesetzt. Hin und wieder habe sie noch Tage, an denen es ihr nicht so gut gehe. An denen das Gefühl der Überforderung sie wieder überkommt. «Vielleicht bin ich nicht mehr ganz derselbe Mensch. Die Leichtigkeit von früher fehlt mir noch», meint sie. Im Gespräch mit der «Liewo» war davon nichts zu spüren. Trotzdem wollte sie ihre Geschichte anonym erzählen. «Es ist nicht so, dass ich nicht dazu stehe. Ich fürchte nur, dass mich mögliche Reaktionen auf den Artikel wieder überfordern könnten», erklärt Michaela und hofft, dass ihre Geschichte hilft, das Tabu in der Gesellschaft aufzubrechen. «Es sind so viele Frauen betroffen. Sie müssen wissen, dass sie nicht alleine sind.»
*Name der Redaktion bekannt.
Hier findest du Hilfe
Eine postpartale Depression ist keine Seltenheit. Rund 10 bis 15 Prozent der Mütter leiden darunter – also sehr viele Frauen. Du bist nicht allein. Scheue dich nicht davor, dir Hilfe zu suchen. Je eher eine postpartale Depression entdeckt wird, desto schneller und besser ist sie behandelbar. Deine Hebamme, der Kinder- oder dein Hausarzt können eine erste Anlaufstelle sein und dich weitervermitteln. Auch schwanger.li bietet bei einer möglichen Wochenbettdepression Hilfe. In der Schweiz setzt sich der Verein Postpartale Depression Schweiz (ehemals Postnatale Depression) für rasche und richtige Hilfe ein. Bei den Anlaufstellen finden selbstverständlich auch Angehörige Hilfe.
Weitere Infos unter www.postpartale-depression.ch
Symptome der postpartalen Depression
- Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit
- Traurigkeit, Weinerlichkeit
- Leeregefühl
- Zweifel daran, eine gute Mutter zu sein
- Appetitstörungen
- Schlafstörungen
- Konzentrationsstörungen
- Ängste und/oder Panikattacken
- Zwangsgedanken (zum Beispiel sich oder dem Kind etwas anzutun)
Risikofaktoren für eine postpartale Depression
- Psychische Erkrankungen vor oder während der Schwangerschaft
- Tod einer Bezugsperson während der Schwangerschaft
- Trennung während der Schwangerschaft
- Jobverlust während der Schwangerschaft
- Schwierige soziale oder finanzielle Situation
- Geburt verläuft anders als geplant (z.B. Kaiserschnitt statt natürliche Geburt)
- Alleinerziehende Mutter
Für Frauen, die bereits einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen waren, ist das Risiko an einer postpartale Depression zu erkranken um 30 bis 60 Prozent erhöht. Diagnostisch ist die Wochenbettdepression von den sogenannten Heultagen bzw. dem Baby Blues und der postpartalen Psychose (PPP) abzugrenzen, die mit Halluzinationen, Wahnvorstellungen und gestörter Wahrnehmung der Realität einhergehen.
Unterstützen auch Sie die Liewo-Weihnachtsspende und helfen Sie psychisch schwer erkrankten Müttern.
Hier können Sie direkt spenden.
Spendenkonto: Vaduzer Medienhaus AG
IBAN: LI78 0880 5503 3632 6001 9
VP Bank, Vaduz | Referenz: SOS-Kinderdorf
Der Erlös der Spendenaktion fliesst vollumfänglich in das Projekt «Mutter-Kind-Therapie in Liechtenstein» vom SOS-Kinderdorf (Liechtenstein) e.V.
Hilfe für psychisch kranke Mütter und ihre Kinder
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
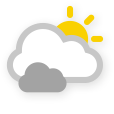








Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.