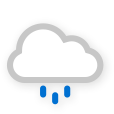«Wir gaben uns gegenseitig richtig Stoff»
Während «Giacobbo Müller» Pause macht, ist Mike Müller (50) in der 2. Staffel des erfolgreichen SRF1-Krimis «Der Bestatter» zu sehen und geht mit dem Solo-Theaterstück «Truppenbesuch» auf Tournee. Der Oltner über seinen neuen Rivalen Carlos Leal, das Verhältnis zu seinem Bruder und sein taktisches Coming-out in der RS.
Verkörpert dieser bedächtige, bodenständige, manchmal auch hölzerne Mike Müller wirklich die Schweiz?
Mike Müller: Das hat Carlos Leal in einem Interview gesagt. Ich kann das nicht beurteilen. Wenn ich den Luc Conrad spiele, habe ich nicht das Konzept einer «bedächtigen Schweiz» im Kopf. «Der Bestatter» ist eine sehr schweizerische Serie mit genügend Bodenständigkeit, aber dem Schuss Skurrilität, der ebenfalls zur Schweiz gehört und mir auch gefällt.
Besteht die Rivalität zwischen Conrad und dem Bundespolizisten Pedro Lambert also auch unter ihren Darstellern?
Überhaupt nicht! Als wir kürzlich gemeinsam zum Thema «Konkurrenz» interviewt wurden, haben wir uns sehr über unser Wiedersehen gefreut. Wir haben uns bei den Dreharbeiten auf Anhieb verstanden, gaben uns vor der Kamera jedoch gegenseitig richtig Stoff. Aber nicht in der Maske, nicht in der Garderobe und nicht beim Essen!
Welche Rolle spielt der frühere Sens-Unik-Sänger und Rapper in der 2. Staffel?
Er bringt einen welschen Schwung hinein, den ich neben diesem doch eher bedächtigen Bestatter als wohltuend empfinde. Sie kommen sich kriminalistisch in die Quere und im Werben um die attraktive Kommissarin Anna-Maria Giovanoli. Ich bin froh, dass wir einen neuen Störfaktor haben. Beim Spielen sucht man nach Reibung, nicht nach Harmonie!
Was sonst ist in der 2. Staffel anders?
Sie ist nicht «komplizierter», aber es ist mehr Fleisch am Knochen. Der eine Fall, der sich durch die ganze Staffel zieht, taucht diesmal nicht in Rückblenden auf, sondern läuft diesmal parallel zu dem abgeschlossenen Fall in den einzelnen Episoden. Das machte die Aufgabe für die Autoren Dominik Bernet, Katja Früh und Claudia Pütz anspruchsvoller. Statt nur 4 hat die zweite Staffel 6 Folgen inklusive eines grossen, actiongeladenen Finales. Das kann und will man sich in Krimiserien sonst nicht leisten, weil es zu teuer ist. Die Drehbuchautoren haben ihre Möglichkeiten bei dieser letzten Episode jedoch voll ausgereizt und das ist toll.
Hat man sich von amerikanischen Serien inspirieren lassen?
Momentan kommt kein Drehbuchautor darum herum, sich mit amerikanischen und skandinavischen Serien auseinanderzusetzen. Diese Produktionen setzen den Standard, dort ist im Moment der Serienhimmel. Auch Regisseure, Schauspieler und unsere Zuschauer schauen sich das an. Die Ansprüche des Publikums sind deshalb gestiegen.
Welche Krimis haben Sie geprägt?
«Ein Fall für Männdli» mit Ruedi Walter hat mir sehr gefallen, später «Miami Vice» und «Der Fahnder» mit Klaus Wennemann und Dieter Pfaff, der mit seinen klaren, auch etwas skurillen Figuren dem «Bestatter» ähnelt. Später kam ? natürlich ? auch der «Tatort». Und jetzt immer wieder «Sopranos» oder «Breaking Bad». Aber alles kann man auch nicht schauen ? zwischendurch lese ich auch gerne mal ein Buch! (lacht)
Vermutlich nicht unbedingt auch noch Krimis, oder?
Es darf ein Krimi sein, aber eher selten. Es gibt auch Bücher, bei denen man auf die Auflösung gespannt ist, die keine Krimis sind ...
Weshalb hat es Sie, im Gegensatz zu einem Carlos Leal, der in Los Angeles lebt, nie ins Ausland gezogen?
Ich konnte hier in der Schweiz immer tolle Sachen machen. Für einzelne Koproduktionen mit der freien Theaterszene ? meist als Koautor und Dramaturg ? nach Deutschland zu gehen, fand ich sehr interessant. Aber jetzt mache ich in der Schweiz so viel, dass dafür gar keine Zeit mehr bleibt.
Arbeiten Sie lieber in Mundart?
Nein, ich ziehe den Dialekt der Hochsprache überhaupt nicht vor. Obwohl ich viel auf Schweizerdeutsch schreibe, bin ich ein Verfechter der Hochsprache. Ich finde, dass man gut Hochdeutsch sprechen muss, um gut Dialekt schreiben zu können. Trotzdem ist das Schweizerdeutsch für mich wichtig, da ich oft über den Dialekt, das Vokabular und die Sprachmelodie meiner Figuren etwas über ihren Charakter auszusagen versuche.
Woran liegt es, dass die TV- und Filmproduktionen im Dialekt nur selten so stimmig wirken wie «Der Bestatter»?
In Deutschland bewegen sich sowohl Autoren wie Schauspieler immer in ihrer Normsprache. Bei uns schreibt man sie nicht. Mundart ist grundsätzlich keine geschriebene Sprache. Obwohl sich dies durch SMS und E-Mails gerade verändert. Eine mündliche Sprache schriftlich festzuhalten und dann wieder zu «vermündlichen», ist ein etwas komplizierter und schwieriger Prozess. Das ist jedoch keine Ausrede, denn es ist unsere Aufgabe als Filmschaffende, uns die Wörter so in den Mund zu legen, dass sie «flutschen».
Fehlt es nicht auch an starken Geschichten und Dialogen?
Natürlich sind das wichtige Faktoren. Und diese hängen auch mit den Strukturen und Budgets zusammen. Bei uns spricht man nicht einmal von einer Industrie. Dafür hat man in Deutschland andere Probleme. Dort haben die grossen Sender einerseits sehr viel Macht, sind aber auch dem enormen Einfluss der politischen Parteien ausgesetzt. Was wir in «Giacobbo Müller» machen, wäre dort unmöglich!
Haben Sie heute mehr Freiheiten als früher?
Nein, der politische Einfluss auf unsere Sendung ist gleich Null, was auch richtig ist bei einem Monopolsender. Man konnte schon immer gegen die eigenen Chefs schiessen. Auch frühere Direktoren haben uns diese Freiheiten gelassen. Sie sind für eine solche Sendung auch unabdingbar, aber nicht selbstverständlich. Bei privaten Medien könnten wir uns solche Sachen wohl nicht erlauben.
Wie viel mehr fühlen Sie sich heute als Kabarettist als zu Beginn Ihrer Zusammenarbeit mit Viktor Giacobbo?
Es ist nicht so, dass Viktor mich aus einem Kohlebergwerk am Südfuss des Jura herausgeholt und mich von meiner Verdingbuben-Existenz erlöst hätte. Ich habe vorher schon humoristische Rollen gespielt. Die Weiterentwicklung war und ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir Kleinkünstler sind ja eigentlich alle Autodidakten. Das hat seine Nachteile, aber auch viele Vorteile. Man muss viele Kollegen anschauen und ins Theater gehen, um herauszufinden, was einem gefällt, und sich dann ausprobieren. Ganze Generationen haben «Emil» oder Texte von Franz Hohler auswendig gelernt, denn sie haben in unserer Branche die Meilensteine gesetzt.
Ihre Auftritte neben Giacobbo im letzten Jahr erschienen mir frecher als früher. Hat der eigenständige Erfolg mit dem «Bestatter» selbstbewusster gemacht?
Wie das wahrgenommen wird, muss ich den Zuschauern überlassen. Sicher habe ich eine gewisse Entwicklung durchgemacht und viel gelernt, schon in «Viktors Spätprogramm» das Drehen von Sketchen und später den Umgang mit dem wachsenden Medieninteresse an meiner Person. Ich hatte das Glück, mit so guten Leuten wie Viktor, (Autor) Markus Köbeli, (Produzent), Peter Irniger oder Birgit Steinegger zusammenarbeiten zu können. Bei Viktor, der bereits 13 Jahre mit einem erfolgreichen Format auf dem Buckel hatte und massiv mehr Fernseherfahrung mitbrachte, konnte ich abschauen, wie man sich locker macht und in die Sendung einbringt. Beim «Bestatter» habe ich wieder viel gelernt, aber nichts, dass die Präsenz beim Moderieren erhöht.
Aber die zusätzliche Popularität dürfte doch beflügeln?
Sie beflügelt, aber nur innerhalb eines Projekts, wenn es weitergeführt werden kann. Ausserdem muss man Lob immer mit Bedacht geniessen, da die meisten Leute nur das Positive zu sagen wagen. Das ist dann nicht alles Realität. Es gibt immer auch Leute, die das, was ich mache, einen «Seich» finden.
Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit des Wartens auf die verspäteten «Bestatter»-Einschaltquoten, die über die Fortsetzung der Serie mitentschieden?
Aufgrund der Internet-Downloads war relativ früh klar, dass es nicht schlecht lief. Ich fand es jedoch spannend, die Fernsehkritiker ohne ihr liebstes Argument zu erleben. Die Quoten scheinen mir für die Presse mindestens ebenso wichtig zu sein wie für den Sender. Dabei kennen viele Journalisten nicht einmal den Unterschied zwischen der Quote und den absoluten Zahlen und vergleichen deshalb oft Äpfel mit Birnen.
Ihre Kinofilme seit «Mein Name ist Eugen» (2005) waren weder Kassenerfolge noch inhaltlich überzeugend, wobei das wohl am wenigsten an Ihrer Leistung lag ...
Es lag nicht nur an mir, aber auch. «Tell» haben wir alle versiebt. «Missenmassaker» würde ich wieder machen. Manchmal kann man wirklich nicht voraussehen, weshalb etwas beim Publikum nicht ankommt.
Haben Sie sich bei Lektüre der Drehbücher verschätzt oder wegen dem Verdienst zugesagt?
«Tell» und «Dead Fuckling Last» waren beide unterfinanzierte Low-Budget-Produktionen. Die habe ich also auf gar keinen Fall wegen des Geldes gemacht. Die «DFL»-Story fand ich eigentlich gut: Drei etwas in die Jahre gekommene Velokuriere, die immer noch auf jung machen und es ihrer Umwelt nochmals zeigen wollen. Zudem mochte ich den Regisseur und den Produzenten. Wir Schauspieler konnten uns stark einbringen. Am Schluss hat der Film sein Publikum aber nicht gefunden. Das muss man akzeptieren. Immerhin habe bei diesem Film wieder Freude am Drehen bekommen, nachdem ich lange Zeit lieber Theater gemacht hatte. «Missenmassaker» war leider zu wenig lustig und zu wenig brutal ... (lacht) Ob ein Genrefilm à la «Scary Movie» überhaupt auf Schweizerdeutsch funktionieren kann, ist eine andere Frage. Aber ich habe gerne mitgespielt.
Wie sind die Solo-Theaterstücke entstanden, mit denen Sie ab Januar wieder unterwegs sind?
«Elternabend» wollte ich zuerst als Gespann mit Rafi Sanchez machen, einem meiner besten Freunde, damals Kodirektor des (Zürcher) Theaters Neumarkt. Für die Recherchen zum Thema Integration habe ich dann meinen Bruder Tobi um Rat gefragt, weil ich vorher noch nie grosse Interviews geführt hatte und er Journalist ist. Schliesslich fand Rafi, dass wir ihn auch gleich engagieren könnten. Da wir drei uns mit unseren unterschiedlichen Stärken sehr gut ergänzen, haben wir nun auch «Truppenbesuch» gemeinsam gemacht.
Was fasziniert Sie an dieser Art Theater?
Es ist wahnsinnig interessant, mit Leuten zusammenzukommen, auf die ich in meinem Beruf sonst nie treffen würde. Du musst eine Vorahnung haben, wohin dich die Interviews führen könnten, aber manchmal auch bereit sein, vorgefasste Meinungen zu revidieren.
Wie bringen Sie das Resultat Ihrer Recherchen auf die Bühne?
Wir montieren verschiedene Aussagen aus den 40 Interviews zum Thema Militär, die wir geführt haben, zum einem Stimmungsbild. Wir fragen uns dabei nicht, weshalb eine Person so spricht wie sie spricht, sondern geben sie einfach wieder. Die Kürzungen und die Komposition machen das Stück trotzdem künstlich und künstlerisch.
Welche eigenen Erfahrungen sind eingeflossen?
Ich bin zwar noch in die RS eingerückt, habe aber am zweiten Tag zum Kadi gesagt: «Ich bin schwul.» Nach 10 Tagen konnte ich zum Psychiater und anschliessend nach Hause gehen. Das war noch die Zeit, in der man als Dienstverweigerer ins Gefängnis gekommen wäre.
Wollten Sie einfach keine Waffe tragen oder hatten Sie politische Gründe?
Es war eine Mischung aus vielem. Natürlich habe ich die Armee abgelehnt, auch, weil sie damals voll von unfähigen Leuten war. Sie war eher gefährlich, als dass sie Schutz geboten hätte. Ich wurde von einem 20-jährigen Juristen, der jünger war als ich, angebellt. Da wusste ich: «Hier bleibe ich nicht!» Ich hatte eine instinktive Abneigung, die ich heute besser erklären kann als damals.
Was haben Sie damals über den Humor der jungen männlichen Schweizer Bevölkerung gelernt?
In diesen 10 Tagen habe ich nichts gelernt ausser, dass auch Berndeutsch schrecklich klingen kann (lacht)! Ich war wirklich froh, als ich nach Hause gehen durfte. Gerecht war es natürlich nicht. Andere haben sich 17 Wochen durchgebissen oder gingen lange ins Gefängnis. Ich konnte nach Hause und habe lange (Wehrdienstersatz) bezahlt. Aber davon hat mich kein Franken gereut! (lacht)
Wie hat «Truppenbesuch» Ihre Meinung über die heutige Armee verändert?
Bei gewissen Dingen habe ich gestaunt, dass sie immer noch gleich sind wie früher. Etwa, dass man mit Schlafentzug und Kollektivstrafen eine Kameradschaft erzeugt, auf die man nachher stolz ist. Diese Blauäugigkeit auf allen Stufen erschüttert mich. Ich denke, über Kameradschaft sollte man mittlerweile mehr wissen. Interessant ist auch eine Umfrage unter Soldaten, die besagt, dass die meisten der wenigen Leute, die noch Dienst leisten, eigentlich sehr motiviert wären, obwohl sie den Sinn nicht erkennen. Eine Armeeführung, die eine Studie mit einem solchen Ergebnis veröffentlicht, ist in vielerlei Hinsicht moderner als ihre Kritiker. Ein hoher Offizier hat auch mit seinem Kader eine Aufführung in Aarau besucht und gleich hinterher bei einer Podiumsdiskussion mitgemacht, ohne vorher jemanden vorbeigeschickt zu haben.
Haben Sie sich mit Ihrem Bruder schon in Ihrer Jugend so gut verstanden, dass Sie sich eine Zusammenarbeit hätten vorstellen können?
Tobi ist sieben Jahre jünger. Wenn man aufwächst, gibt es Phasen, in denen man viel und dann auch wieder sehr wenig miteinander zu tun hat. Wir standen uns immer nahe, aber in einer gesunden Distanz. Meinem Vater war es wahnsinnig wichtig, dass der Grössere den Kleineren nicht erzogen hat. So haben wir uns immer sehr gemocht. Trotzdem mussten wir uns für dieses Projekt ? auch wegen der unterschiedlichen Funktionen ? zuerst wieder etwas annähern. Auf keinen Fall wollte ich jedoch unsere gute Beziehung aufs Spiel setzen.
Wie gelassen gehen Sie damit um, dass Sie seit dem 25. Oktober 50 Jahre alt sind?
Mein Körper hat mir schon früher gesagt, dass ich besser nicht alle Dinge ganz so gelassen angehen sollte (lacht)! Das Alter ist eine Sache, aber du kannst auch einfach Pech haben mit der Gesundheit. Ich bin bis jetzt vor grossen Schicksalsschlägen verschont geblieben. Ich empfinde das als grosses Glück. Sollten sie doch einmal kommen, muss ich schauen, wie ich damit umgehen werde.
Über welche Persönlichkeiten werden wir 2014 lachen?
Ich hoffe, dass es genügend Leute geben wird, die uns dazu bringen. Wer das sein wird, weiss ich nicht ? dazu bin ich zu wenig Prophet.
Der neue Papst gibt für Satiriker nicht mehr so viel her wie sein Vorgänger ...
Trotzdem wird auch er Schlagzeilen machen. Es wäre jedoch lächerlich, wenn ich als Atheist sagen würde, Franziskus stünde mir näher als Benedikt. Beide sind sehr weit weg.
Für welche Ihrer «Giacobbo Müller»-Figuren wünschen Sie sich besonders guten Stoff?
Wen ich am liebsten parodiere, kann ich nicht sagen. Wenn wir uns am Dienstag entscheiden müssen, mit welchen Figuren wir Sketches für den Sonntag machen, ist die Hauptsache, wir haben zündende Ideen. Es gibt jedoch Tage, an denen ich mir eine Figur wünschen würde, für die ich nicht so lange in der Maske sitzen müsste ... Kim braucht seine Zeit. Armin Grütter geht sehr schnell. Falls allerdings der Aufwand je entscheidend würde, müssten wir sofort aufhören.
Der Bestatter», dienstags um 20.05 Uhr auf SRF1
Mit seinem Theater «Truppenbesuch» ist Mike Müller am 7. März im Altes Kino Mels zu Besuch.