Die Auswirkungen der US-Steuerreform
Im Wesentlichen beinhaltet der von Präsident Donald Trump unterzeichnete «Tax Cuts and Jobs Act» für Unternehmen die folgenden Hauptelemente: Eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 35 Prozent auf 21 Prozent; eine zeitlich befristete Sofortabschreibung für Investitionen; eine Steuerfreistellung von Dividenden aus Beteiligungen von mindestens 10 Prozent und ein Präferenzregime für immaterielle Wirtschaftsgüter. Eine Gegenfinanzierung erfolgt vor allem durch eine Verbreiterung der Steuerbasis. Künftig werden gewisse Abzüge nicht mehr steuerlich zugelassen oder eingeschränkt wie zum Beispiel der Zinsabzug. Des Weiteren werden durch Mindestbesteuerungsvorschriften auf ausländischen Erträgen die Defizite teilweise kompensiert.
Dividendenbesteuerung
US-Unternehmen haben bisher einen Grossteil der Gewinne ihrer Auslandsgesellschaften in Niedrigsteuerländern parkiert, da eine Ausschüttung signifikante steuerliche Folgen in den USA hatte. Der jetzige Wechsel hin zu einem sogenannten territorialen Steuersystem, wie wir es auch in Liechtenstein und der Schweiz kennen, bei welchem Gewinne ausländischer Tochtergesellschaften nicht besteuert werden, wird diese Praxis zukünftig ändern. Damit diese Gewinne, deren Umfang auf circa 2,6 Billionen US-Dollar geschätzt wird, jedoch nicht komplett unbesteuert in die USA fliessen, werden sie einmalig mit Sätzen von 8 Prozent (illiquide Anlagegüter) und 15,5 Prozent (Finanzmittel) nachversteuert. Diese Besteuerung erfolgt unabhängig von einer tatsächlichen Ausschüttung. Es ist daher anzunehmen, dass diese Änderungen zu einem bedeutenden Abzug von Kapital aus dem Ausland, und entsprechend auch aus der Schweiz und Liechtenstein, führen könnte.
Immaterielle Wirtschaftsgüter
Durch die Einführung eines neuartigen und sehr weitreichenden Präferenzregimes gewinnen die USA zusätzlich an Attraktivität. Hierbei werden Einkünfte aus der ausländischen Verwertung immaterieller Wirtschaftsgüter durch US-Unternehmen (foreign-derived intangible income «FDII») mit niedrigen Steuersätzen von 13,125 Prozent im Jahr 2018 bis 16,406 Prozent ab 2026 besteuert. Aufgrund der Tatsache, dass diese Regelung nur für Fälle mit Auslandbezug anwendbar ist, ist hier die Absicht zu erkennen, die USA als Standort für geistiges Eigentum, Patente und Lizenzen attraktiver zu machen.
Bei der Einführung dieses Präferenzregimes handelt es sich gewissermassen um die Ausgestaltung einer sogenannten Patentbox-Regelung, welche in Liechtenstein nach ihrer Abschaffung bisher noch nicht wieder neu aufgelegt wurde.
Zur Bekämpfung vermeintlicher Missbrauchsstrukturen, insbesondere des «Offshoring» von immateriellen Wirtschaftsgütern, wird im Zuge der Reform die Hinzurechnungsbesteuerung ausgedehnt. Die Einkünfte ausländischer Gruppengesellschaften, die aus der Verwertung von immateriellen Wirtschaftsgütern stammen und im Ausland einer niedrigen Besteuerung unterliegen, werden in den USA hinzugerechnet und mit einer zusätzlichen Besteuerung von 10,5 Prozent und später 13,125 Prozent belastet (global intangible low-taxed income «GILTI»).
Zinsabzugsbeschränkung
Auch die USA führt im Zuge der Reform als Massnahme zur Gegenfinanzierung eine Zinsabzugsbeschränkung ein. Hierbei ist der gesamte Nettozinsaufwand eines Unternehmens nur noch bis zu einer Höhe von 30 Prozent des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sofort abzugsfähig. Ab dem Jahr 2022 wird die 30-Prozent-Grenze jedoch auf das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bezogen und ist dann sogar noch sehr viel enger gefasst als vergleich-bare Regelungen in der EU wie z. B. die EU-Zinsschrankenregelung. Der nicht abzugsfähige Teil des Zinsaufwands kann per Zinsvortrag in zukünftigen Jahren genutzt werden. Die Beschränkung des Zinsabzugs dient hauptsachlich der Erhaltung des US-Steueraufkommens und hat nicht primär einen Standortvorteil zur Folge.
Base Erosion and Anti-Abuse Tax
Die neu eingeführte Base Erosion and Anti-Abuse Tax («BEAT») greift, wenn eine US-Gesellschaft ihren Gewinn durch Auslandszahlungen an Gruppengesellschaften so stark minimiert, dass diese Gesellschaft eine bestimmte US-Steuerquote unterschreitet. Die BEAT hat somit eine Mindestbesteuerung von bestimmten Zahlungen ins Ausland zur Folge, welche in drei Schritten von 5 Prozent im Jahr 2018 bis zu 12,5 Prozent im Jahr 2026 ansteigt. Davon ausgenommen sind Zahlungen für den Wareneinkauf sowie Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von unter 500 Millionen US-Dollar. Auch durch diesen Teil der Reform erhoffen sich die USA erhebliche Steuereinnahmen. Als Reaktion könnten betroffene Unternehmen auch aufgrund dieser Massnahme beginnen, gewisse Auslandsaktivitäten in die USA zu verlagern.
Fazit
Insgesamt dürfte aufgrund der US-Steuerreform für die meisten amerikanischen Unternehmen eine merkliche Steuerentlastung resultieren. Durch die niedrigere Steuerbelastung im Zusammenhang mit den belastenden Massnahmen für Einkünfte mit Auslandsbezug gewinnt die USA zukünftig als Standort für Unternehmen wieder an Attraktivität. Jedoch bleibt festzuhalten, dass aufgrund der Vielzahl der neuen Elemente und Regelungen die Reform als solche keine Vereinfachung des sehr komplexen amerikanischen Steuersystems zur Folge hat, sondern dass sich die steuerliche Situation für Unternehmen auch weiterhin sehr unübersichtlich und kompliziert gestalten wird. Viele Unternehmen mit starkem US-Bezug evaluieren derzeit die konkreten Konsequenzen der Reform und prüfen mögliche Handlungsszenarien.


*Marina Berther
Senior Manager, dipl. Steuerexpertin, Red Leafs Tax Advisory AG, Ruggell
*Priska Rösli
Partner, dipl. Steuerexpertin, Red Leafs Tax Advisory AG, Ruggell.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
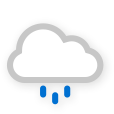






Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.