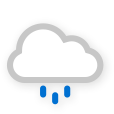«Ballooning» um vorwärtszukommen
Vaduz. – Caracladus zamoniensis heisst eine Zwergspinnenart, die in unseren Breitengraden lebt. Ihrem Aussehen nach könnte sie aus Zamonien stammen – Walter Moers erfundenem Roman-Kontinent, welcher von Käpt’n Blaubär und anderen fantastischen Figuren bewohnt wird. Denn die ein bis zwei Millimeter grosse Spinne hat eine ähnliche «Nase» wie die Bewohner des Fantasiekontinents. Allerdings ist diese nur mit dem Mikroskop zu erkennen. Der Balzner Holger Frick vom Amt für Wald, Natur- und Landschaft ist der Entdecker von Caracladus zamoniensis oder auf Deutsch: Caracladus aus Zamonien. Er fand sie 2007 in den Bündner Alpen. Da die Spinne noch keinen Namen hatte, durfte er ihr einen geben.
Unpraktische Ausstülpung
Die absonderliche Kopfform mit der grossen Nase haben nur die Männchen. Allerdings ist die Nase keine Nase, sondern eine Art Ausstülpung des Vorderkörpers, auf der die Augen sitzen. Weshalb die Männchen diese Kopffortsätze haben, ist kaum erforscht. Denn für die Lebensweise der Spinnen zwischen Nadelstreu sind sie eigentlich völlig unpraktisch. «Deshalb wird vermutet, dass sie nur da sind, um die Weibchen zu beeindrucken», sagt Holger Frick. Der Stammbaum der Gattung Caracladus zeigt, dass sich diese Ausstülpungen von unscheinbaren Erhöhungen zu immer grösseren und spezielleren «Nasen» entwickelt haben. Untersuchungen bei einer anderen Zwergspinnenart, Hypomma bituberculatum, haben gezeigt, dass sich das Weibchen bei der Paarung an diesen Kopfstrukturen festhält, ihren Speichel über den Kopf verteilt und ihn dann wieder aufsaugt. «Man nimmt an, dass sie dadurch Sekrete des Männchens, die aus Drüsen an seinem Kopf stammen, aufnimmt und daran attraktive von weniger attraktiven Männchen unterscheiden kann», sagt Holger Frick.
Artenreiche Spinnengruppe
Zwergspinnen gehören zu den Baldachinspinnen, die artenreichste Spinnenfamilie der Nordhemisphäre. Bis heute wurden 4314 verschiedene Arten dieser Spinnenfamilie beschrieben. Es ist aber anzunehmen, dass noch viele Arten, vor allem in Sibirien und weltweit in den Bergregionen, bisher unentdeckt blieben. In der Schweiz sind sie die artenreichste Gruppe der Spinnen: rund 300 Arten von Zwergspinnen leben dort. «In Liechtenstein sind es schätzungsweise etwa 200 Arten», sagt Holger Frick. Es leben also Tausende, ja Millionen von Zwergspinnen im Land – 30 Prozent aller Spinnen in Liechtenstein sind Zwergspinnen. Wer sich also gemütlich in eine Wiese setzt und ein bisschen Geduld hat, bekommt bestimmt eine der winzigen Spinnen zu sehen. Zwergspinnen leben vorwiegend am Boden – im Gras oder zwischen Nadel- und Laubstreu. Dort machen sie aus der Spinnseide ein kleines Gespinst, das als Unterschlupf dient. Da lauern sie kleinen Insekten, wie Springschwänzen, auf oder verfolgen sie, um sie zu fressen.
Lieben die Kälte
Die meisten Lebewesen haben die höchste Artenvielfalt in den Tropen. «Zwergspinnen sind hierbei eine seltene Ausnahme», sagt Holger Frick. Die kleinen Spinnen mögen es lieber kühl. Aus diesem Grund haben sich einige Arten auf ein Leben im Winter spezialisiert. Sogar unter der Schneedecke kommen einige Zwergspinnen, zum Beispiel die Caracladus zamoniensis, vor. Aus diesem Grund sind sie fern des Äquators, an kälteren Orten wie in unseren Breitengraden, viel artenreicher.
«Fliegen» als Transportmittel
Aussergewöhnlich ist auch die Verbreitungsstrategie der Zwergspinnen. Diese nennt sich «ballooning» oder auch «luftschiffen». Dazu klettern sie auf eine Erhöhung, strecken ihren Hinterleib in die Luft und produzieren einen sogenannten Flugfaden aus Spinnseide. Ist der Faden lang genug, wird er vom Wind erfasst und zieht die Spinne mit. Besonders im Altweibersommer ist dieses Phänomen zu beobachten. Wenn sich die kühle Winterluft über dem Boden durch die Sonneneinstrahlung erwärmt, lässt sich die Spinne emporheben und verfrachten. «Dies kann man gut beobachten. Man hat das Gefühl, die Luft flimmert, dabei sind es Tausende von Fäden, mit jeweils einer Zwergspinne am hinteren Ende», erklärt Holger Frick. Sie können massenhaft auftreten, aber wenig später schon wieder verschwunden sein. Die Spinnen können dabei mehrere Tausend Meter Höhe erreichen und mehrere Hundert Kilometer weit fliegen.
Mit dieser Strategie fällt es Zwergspinnen nicht schwer, sich auszubreiten und neue Orte zu besiedeln. Dies zeigt das Beispiel der indonesischen Vulkaninsel Krakatau, die im Jahre 1883 durch einen Vulkanausbruch komplett zerstört wurde. Bereits ein Jahr nach dem Unglück konnten die ersten Spinnen auf der Insel entdeckt werden, die sich dank dem «Ballooning» auf der Insel niedergelassen hatten. (manu)
Schlagwörter
-
Wirbellose Tiere