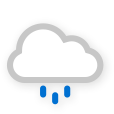«Ich brauche keine Manolo-Blahnik-Schuhe»
Frau Vetsch, Sie sind Journalistin. Welche Frage würden Sie sich selbst stellen wollen?
Mona Vetsch: (überlegt) Hmmmm ... So spontan weiss ich darauf keine Antwort. Darf ich am Schluss des Interviews einen Rückkommensantrag stellen? Dann weiss ich, welche Frage noch fehlt.
Na klar, ich bin gespannt ... In diesem Jahr moderierten Sie das vierte Mal den Businesstag für Frauen in Liechtenstein. Liegt Ihnen das Thema «Frauen in der Wirtschaft» am Herzen?
Meine beruflichen Entscheidungen treffe ich meistens nach dem Bauchgefühl. Ich arbeite gerne für Projekte, die ich auch toll finde. Und der Businesstag ist so ein Anlass. Man trifft dort sowohl von den Referentinnen wie auch von den Besucherinnen her auf super Frauen. Ich habe zwei Jahre an der HSG St. Gallen Wirtschaft studiert und moderiere viele Wirtschaftsanlässe. Speziell bei Frauen sehe ich meine Hauptbotschaft darin, sie zu motivieren, sich mehr hinzustellen und ihre Meinung zu vertreten.
Haben Sie im Rahmen dieser Moderationen auch Zeit gehabt, etwas von Liechtenstein zu sehen, oder sind Sie einfach so durch das Land «gewischt»?
Ich bin «durchgewischt» worden (lacht). Ich werde in der Regel am Bahnhof Sargans abgeholt, zum Anlass gefahren und kurz darauf sitze ich auch schon wieder im Zug. Bisher hatte ich nie Zeit, Liechtenstein zu besichtigen. Sollte ich sie mir einmal nehmen?
Ich denke schon, dass es sich lohnen würde.
Wobei, jetzt fällt mir ein, dass ich doch etwas von Liechtenstein kenne – und zwar den Schlossgarten. Für die DRS3-Sendung «Fokus» hatte ich einmal das Vergnügen, eine Stunde mit dem Erbprinzen in seinem wunderbaren Garten zu sitzen und ein Gespräch zu führen. Im Hintergrund plätscherte idyllisch ein Bächchen.
Dann haben Sie schon mehr gesehen als die meisten Liechtensteiner.
Ja, wer kann schon von sich behaupten, beim Erbprinzen eine Audienz gehabt zu haben. Da bin ich stolz drauf (lacht).
Sie gelten als frechste Fernseh- und Radiomoderatorin der Schweiz. Waren Sie bereits als Kind nicht auf den Mund gefallen?
Meine Mutter sagt immer, als Kind hätte ich in meinem Leben noch nicht so viel zu reklamieren gehabt, die freche Art hätte ich erst später entwickelt (lacht). Allerdings würde ich nie von mir selbst behaupten, dass ich frech bin. Frech sein hat was mit respektlos zu tun, und das bin ich definitiv nicht. Ich bin direkt – und das war ich schon als Kind. Auch habe ich viel geredet und immer den Kontakt zu Leuten gesucht.
Denken Sie, das hat damit zu tun, dass Sie als Bauernkind aufgewachsen sind? In einem so bodenständigen Umfeld spricht man doch gerne mal Klartext.
Schon möglich. Ich bin mit drei Geschwistern in einer grossen Familie auf dem Seerücken im Thurgau aufgewachsen. Wenn man da gehört werden will, muss man sich schon durchsetzen können. Das Leben in meinem Heimatort ist grundsätzlich angenehm bodenständig. Niemand verschwendet dort Energie damit, sich zu überlegen, wie er auf andere wirken könnte. So ein Umfeld hilft schon, direkt zu sein und keine Angst davor zu haben, dass man am Ende mit abgesägten Hosen dastehen könnte.
In Ihren Interviews nehmen Sie kein Blatt vor den Mund.
Ich bin der Meinung, dass man alles fragen kann, wenn man damit umgehen kann, was vom Gegenüber zurückkommt. Mit einer einzigen Frage kann man einen Interviewpartner für die restlichen 30 Minuten verärgern. Grundsätzlich zeigt meine Erfahrung aber, dass die meisten Leute daran wachsen, wenn man ein bisschen «zündet», sie herausfordert. In Interviews ist es nicht angesagt, zu nett zu sein.
Wie gehen Sie denn mit Kritik an der eigenen Person um?
Mit Herausfordern meinte ich nicht, dass ich meinen Interviewpartnern ständig an den «Karren» fahre. Ich meine nur, dass man auf der menschlichen Ebene etwas kecker sein sollte und sich auch getraut, Sachen anzusprechen.
Aber um die Frage trotzdem aufzugreifen: Wie sieht es mit der eigenen Kritikfähigkeit aus?
Ich glaube, mit Kritik können wir alle nicht umgehen. Ich treffe ganz viele Menschen, die sagen, dass sie wahnsinnig kritikfähig sind. Vergiss es. Niemand wird gern kritisiert. Ich auch nicht.
Lesen Sie überhaupt Ihre eigene Kritik?
Also ich gehöre nicht zu denen, die sich regelmässig googeln. Da wird zu viel geschrieben, was mich persönlich nicht weiterbringt. Aber vom Radio und vom Fernsehen bekommen wir immer einen Medienspiegel mit den Kritiken zugestellt, die über uns geschrieben werden. Es gehört dazu, dass man das liest. Aber natürlich wird jeder lieber gelobt. Und glücklicherweise habe ich auch viel mehr mit positivem Feedback zu tun.
Ich muss zugeben, ich war immer ein grosser Fan Ihrer Sendung «Fernweh» und dachte mir, Mona Vetsch hat den Traumjob schlechthin ergattert und reist von Berufs wegen an die schönsten Plätze dieser Welt. Waren die Dreharbeiten zur Sendung wirklich so toll, wie ich mir das immer ausgemalt habe?
Es ist definitiv ein absoluter Traumjob. Aber eben, der Traum ist das eine und der Job das andere. Es ist vor allem harte Arbeit und anstrengend – gerade im Vergleich zu Studiosendungen. Im Fernsehen sieht man nicht, wie viel wir neben dem Filmen auch noch herumreisen. Für das Fernsehen braucht man immer das beste Licht, und das ist bei Sonnenaufgang. Das bedeutet, um 5 Uhr morgens ist man meistens schon unterwegs zum Drehort. Und von dort gehts auch schon weiter zur nächsten Location. Das zweitbeste Licht ist bei Sonnenuntergang, somit arbeitet man immer bis rund 20 Uhr und fährt dann weiter. Das ist ein enger Zeitplan.
Welche Destination Ihrer vielen Reisen hat Sie am meisten beeindruckt?
Extrem spannend war Spitzbergen in der Arktis, wo wir den Eisbären suchten. Ausserhalb der Ortschaft Longyearbyen gibt es praktisch nichts und wir bewegten uns mit Schneescootern durch die Wildnis. Eigentlich denkt man, dass es dort ja nur Schnee, Eis, Himmel und Meer gibt. Aber die Landschaft sieht je nach Lichtverhältnissen immer wieder anders aus. Irrsinnig schön. Besonders ist auch das Gefühl, zu wissen, dass man hier weit weg von allem ist. Da gibt es keine Strassen, keine Häuser, kein Handy und keine Rega, welche dich im Notfall rettet. Ein eindrückliches Erlebnis.
Mittlerweile reisen Sie nicht mehr für die Sendung. Hat Sie das Fernweh seither noch nicht wieder gepackt?
Dafür hatte ich in den letzten Monaten viel zu viel zu tun. Es waren sehr schöne Jahre, aber alles hat seine Zeit. Ich habe die Reisesendungen gemacht, als ich noch frei und ungebunden war. Da spielte es keine Rolle, wenn man mal vier Wochen weg war. Aber jetzt, wo ich Familie habe, setzt man seine Prioritäten neu.
Letzten Sommer haben Sie ja Ihren zweiten Sohn bekommen und schon stehen Sie wieder im Arbeitsleben, moderieren sowohl bei Radio DRS3 wie auch beim Schweizer Fernsehen. Ein toughes Programm. Haben Sie einen Tipp für arbeitende Mütter, wie man das alles unter einen Hut bekommt?
Meine Erfahrung zeigt mir, dass es zwei
Typen von berufstätigen Frauen gibt: Entweder sie sind in einem Bereich tätig, wo sie so viel Geld verdienen, dass sie sich eine Nanny leisten können. Oder sie können bzw. wollen das nicht. In diesem Fall muss man als Paar gut überlegen, wie man die Aufgaben aufteilen kann. Es wird schwer, wenn die Lösung am Ende so aussieht, dass die Frau arbeiten geht und dann noch den ganzen Haushalt und die Kinderbetreuung alleine «stemmen» muss. Mein Tipp lautet deshalb: Innerfamiliäres Job Sharing. Mann und Frau teilen sich zu gleichen Anteilen Kinder, Haushalt und Erwerbsarbeit.
Sie selbst regeln also die Kinderbetreuung gemeinsam mit Ihrem Mann?
Genau. Und an zwei Tagen sind die Kinder in der Krippe. Es fördert enorm das gegenseitige Verständnis, wenn beide wissen, dass man nach einem Tag zu Hause unter Umständen müder und kaputter ist, als nach einem 12-Stunden-Arbeitstag. In meinen Augen hat ein Mann auch ein Recht darauf, seine Kinder aufwachsen zu sehen und zu wissen, was Haushaltsarbeit bedeutet.
Und Sie arbeiten ja offensichtlich auch gerne.
Ich könnte es mir gar nicht anders vorstellen. Für mich war immer klar, dass ich beide Welten erhalten will. Die Kinder werden ja schnell gross. Dann ist es gut, wenn man noch einen Fuss im Arbeitsleben hat. Wichtig ist, dass man zu seinem Partner ehrlich ist und das Thema bespricht, bevor Kinder in die Welt gesetzt werden. Das Modell muss für beide stimmen.
Früher kannte man Sie als freche Moderatorin mit knallbunten Haaren. Heute wirken Sie sehr seriös – nicht nur optisch, sondern auch in der Auswahl Ihrer Sendungen. Würden Sie sagen, dass Sie erwachsen geworden sind?
(sichtlich genervt) Bei dieser Frage, die bei jedem Interview kommt, antworte ich immer: Nehmen Sie einmal ein Foto von sich selbst! Jeder, der mit 37 Jahren noch gleich aussieht wie mit 20, hat in meinen Augen ein Problem. Nicht umgekehrt! Man verändert sich wahrscheinlich nie so stark wie in dieser Zeit. Ich führe heute ein anderes Leben und es interessieren mich ganz andere Sachen. Zum Glück auch. Es wäre doch eine Horrorvorstellung, wenn ich noch heute mit rotgefärbten Haaren eine Jugendsendung moderieren müsste.
Trotzdem haftet so ein Image gerne an einer Person.
Häufig liegt genau hier das Problem begraben, dass man auf ein bestimmtes Image festgenagelt wird. Das führt direkt ins Verderben. Ich bin dankbar, dass das Schweizer Fernsehen die Entwicklung auch zulässt. Ich bin ja nicht von der Jugendsendung direkt aufs «Club»-Sofa gehüpft. Dazwischen liegen Jahre.
Was für eine Note wollen Sie der Diskussionssendung «Club» geben, die Sie seit Anfang des Jahres neben Redaktionsleiterin Karin Frei moderieren?
Ich möchte, dass die Gespräche aufrichtig sind. Mir ist wichtig, dass die Leute, die in den Club kommen, bereit sind, zu diskutieren. Das heisst nicht nur, ihre eigene Position loszuwerden, sondern auch den anderen zuzuhören. Als weiteren Punkt fände ich es schön, wenn man es trotz ernsthafter Themen schafft, eine beschwingte, lustvolle Diskussion zu haben. Es soll über alles mit einer gewissen Lockerheit debattiert werden können und auch mal Lachen oder ein paar «zündende» Sprüche sollen erlaubt sein – immer mit dem dazugehörigen Respekt vor dem anderen.
Gibt es einen Traum, den Sie sich in Ihrem Leben noch verwirklichen wollen?
(überlegt lange) Ich muss sagen, in solchen Fragen bin ich total schlecht. Das hat damit zu tun, dass ich eigentlich schon lange dort bin, wo ich immer hin wollte. Als Kind träumte ich davon, Radio zu machen. Das habe ich erreicht. Es ist ein Privileg, sagen zu können, dass man tagtäglich das macht, was man sich immer wünschte. Wenn es so wäre, dass man im Jenseits irgendwann mal dafür ausgezeichnet würde, dass man 80 Jahre gelitten hat und unten durch musste, nur um einen bestimmten Traum zu verwirklichen, wäre ich ein schlechter Kandidat auf eine Medaille.
Das heisst also, Sie leben Ihren Traum.
Ich lebe extrem im Hier und Jetzt. Ich muss mir nichts erträumen. Ich habe ein tolle Familie, einen super Mann. Wir wohnen an einem schönen Ort. Wir haben weder eine Villa noch einen Swimming-Pool, kein grosses Auto und keinen begehbaren Wandschrank. Und ich habe auch keine Manolo-Blahnik-Schuhe. Das brauche ich alles nicht.
Eine bodenständige Lebenseinstellung.
Vielleicht kommt es auch daher, dass ich vom Land komme. Meine Träume sind auf einen kleinen Radius beschränkt. Für mich ist es einfach das Wichtigste, dass ich das machen kann, was mir Freude bereitet. Und dass ich eine Familie habe, die mich gern hat und bei der ich mich wohlfühle. Viel mehr kann man sich nicht wünschen.
Zum Schluss würde ich gerne auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Welche Frage würden Sie sich den nun selber stellen wollen?
Oh ... Mann, bin ich froh, dass ich mich nie selbst interviewen muss. (lacht) Schon interessant, bei allen anderen weiss ich immer sofort, was ich fragen könnte (überlegt, während sie mit der Zunge schnalzt) ... Doch, jetzt weiss ich es: Ich würde mich fragen, was ich mir wünschen würde, was meine Söhne in etwa 25 Jahren über ihre Mutter sagen.
Und wie würde die Antwort lauten?
So spontan weiss ich es nicht. Aber ehrlich gesagt interessiert es mich selbst, was ich antworten würde. Das werde ich mir mal überlegen. (Interview: ne)
Mehr aktuelle Sommerthemen im neuen «lifestyle» heute als Beilage zu Ihrem «Liechtensteiner Vaterland» oder als E-Paper.